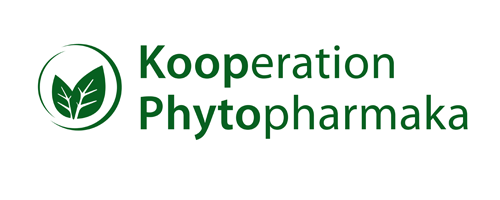Botanische Bezeichnung
Rizinusstrauch - Ricinus communis L.
Familie
Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae)
Wissenswertes zur Pflanze
Die Heimat des Rizinusstrauchs ist bisher nicht geklärt. Seine Samen fanden sich in ägyptischen Gräbern der Zeit 4000 Jahre v. Chr., trotzdem bleibt offen, ob die Heimat des Rizinusstrauches Indien oder Äthiopien war. Heute ist er als Kultur in allen wärmeren Ländern bekannt und wächst in den Mittelmeerländern als 3 bis 5 m hoher baumartiger Strauch, in den Tropen und Subtropen wird er bis 12 m hoch. Nördlich der Alpen und im gemäßigten Amerika erreicht er eine Höhe von nur 2 m und ähnelt so eher einem buschigen Kraut. Dabei ist er außergewöhnlich schnell wachsend, weswegen er auch „Wunderbaum” oder „Wunderpalme” genannt wird. Bemerkenswert sind am Rizinus die großen, lang gestielten, handförmig gelappten Blätter. Sie sind grünlich oder rötlich. Der Blütenstand ist rispig, 15 bis 50 cm lang, im unteren Bereich stehen büschelig gehäuft die männlichen Blüten, oben stehen gestielt die weiblichen Blüten.
Seine dekorativen Samen erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie liegen in walnussgroßen, weich bestachelten, dreifächrigen Kapseln, in jedem Fach ein Samen. Die Samen sind bohnengroß und haben eine harte, rötlich-bräunlich marmorierte Schale. Die marmorierte Maserung soll einer Hundezecke oder einem Holzbock (lat. ,ricinus') ähnlich sehen, so jedenfalls erklärt man sich den Gattungsnamen Ricinus. Das Artepitheton communis bedeutet gewöhnlich/gemein, d.h. weit verbreitet und nicht selten.
Rizinussamen werden in Indien und Afrika zu dekorativen Schmuckketten verarbeitet. Dies ist nicht ganz ungefährlich, da die Samen hoch giftig sind (Vorsicht Kinder!). Sie enthalten das Ricin, ein aus zwei Ketten bestehender Eiweißkörper (Protein). Dessen B-Kette vermittelt der A-Kette die Aufnahme in die Zelle, wo sie das Ribosom inaktiviert und die Proteinsynthese der Zelle stoppt. Diese reagiert darauf mit dem programmierten Zelltod (Apoptose). Folgen einer Vergiftung sind Übelkeit, blutiges Erbrechen, blutiger Durchfall, zuletzt Kreislaufkollaps.
Arzneilich verwendete Pflanzenteile (Droge)
Verwendet wird das fette Öl der Samen, das durch Kaltpressung aus den Samen gewonnen wird (Natives Rizinusöl - Ricini oleum virginale). Das giftige Ricin geht nicht ins Öl über, sondern verbleibt im Presskuchen, der als Düngemittel verwendet wird.
Inhaltsstoffe der Droge
Rizinusöl besteht zu 70% aus Triricinolein, ein Triglycerid der ungesättigten Rizinolsäure (12-Hydroxyölsäure); weitere Fettsäuren sind Öl-, Linol-, Palmitin- und Stearinsäure; ß-Sitosterol.
Qualitätsbeschreibungen
Die Qualität folgender Drogen ist im Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) festgelegt:
- Natives Rizinusöl (Ricini oleum virginale)
- Raffiniertes Rizinusöl (Ricini oleum raffinatum)
- Hydriertes Rizinusöl (Ricini oleum hydrogenatum)
Medizinische Anwendung
Anerkannte medizinische Anwendung
Das HMPC hat Rizinusöl als Abführmittel zur kurzzeitigen Behandlung einer gelegentlich auftretenden Obstipation als „medizinisch anerkannt“ („well-established use“) akzeptiert.
ESCOP: Rizinusöl wurde bisher nicht bearbeitet.
Die Kommission E konnte aus zeitlichen Gründen Rizinusöl nicht mehr
bearbeiten. Seine abführende Wirkung, bedingt durch die
Rizinolsäure, wird phytotherapeutisch genutzt (Schilcher:
Leitfaden Phytotherapie). Anwendungsgebiet: zur kurzfristigen
Anwendung bei akuter und habitueller Verstopfung; Erkrankungen, bei
denen eine zuverlässige Entleerung des Darms erwünscht ist.
Da Rizinusöl im Gegensatz zu allen anderen Ölen in verdünntem Alkohol (70 %) löslich ist, wird es in Alkohol (70 %) gelöst auch als Haar- und Hautpflegemittel benutzt.
Traditionelle Anwendung
entfällt
Arzneiliche Drogenzubereitungen in Fertigarzneimitteln
Keine Fertigarzneimittel; das Öl kann direkt, evtl. geschmacklich verbessert mit Himbeersirup, oder in Weichgelatinekapseln verabreicht werden.
Dosierung
1 bis 2 Esslöffel bzw. 4 bis 6 g (10 bis 30 mL) als einmalige Gabe. Bei höherer Dosierung tritt die Stuhlentleerung innerhalb von 2 bis 4 Std. ein, bei niedrigerer Dosierung nach 6 bis 8 Std..
Bereitung eines Teeaufgusses
entfällt
Hinweise
Rizinusöl darf nur kurzfristig, also nicht länger als 1 bis 2
Wochen, eingenommen werden. Rizinusöl darf nicht eingenommen werden
bei Darmverschluss, akut-entzündlichen Erkrankungen des Darms
(Colitis ulcerosa, Morbus Crohn), bei Bauchschmerzen unbekannter
Ursache und bei Gallenwegserkrankungen.
Während der Schwangerschaft darf Rizinusöl nicht eingenommen
werden, da durch die resorbierte Rizinolsäure in den Blutgefäßen
Prostaglandin E2 freigesetzt wird, wodurch Kontraktionen
des Uterus ausgelöst werden können. Auch während der Stillzeit
wird von einer Anwendung von Rizinusöl abgeraten. Bei der Anwendung
bei Kindern und Jugendlichen muss die Dosis verringert
werden (5 bis 15 mL).
Nebenwirkungen
In Einzelfällen krampfartige Magen-Darm-Beschwerden
Wechselwirkungen
Arzneimittel mit einer geringen therapeutischen Breite (z.B. Digitalispräparate, Marcurmar) dürfen nicht gleichzeitig eingenommen werden, sondern erst nach der Darmentleerung.
Literaturhinweise
Drogenmonographien
Weiterführende Literatur
Schilcher: Leitfaden Phytotherapie
Van Wyk: Handbuch der Arzneipflanzen
Kommentar zum Europäischen Arzneibuch (Natives Rizinusöl, Nr.0051;
Raffiniertes Rizinusöl, Nr. 2367; Hydriertes Rizinusöl, Nr. 1497)